In seiner ersten programmatischen Rede als Verteidigungsminister macht Martin Pfister deutlich, dass die die Schweiz sicherheitspolitisch neue Wege gehen soll. Angesichts globaler Umbrüche und schwindender Gewissheiten rückt der Mitte-Bundesrat von der traditionellen Neutralität ab – und plädiert für eine stärkere Einbindung in die europäische Verteidigungsarchitektur.
Der Zuger Martin Pfister ist seit einem Monat Chef des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), also Verteidigungsminister. Statt einer 100-tägigen Schweigefrist legt er rasch seine sicherheitspolitischen Leitlinien offen – und die haben es in sich. In seiner Rede vor der Allianz Sicherheit Schweiz warnt Pfister eindringlich vor einem zunehmend gefährlichen sicherheitspolitischen Umfeld und fordert tiefgreifende Veränderungen.
Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine habe, so Pfister, «die Illusion eines dauerhaften Friedens in Europa zerstört». Noch gravierender sei jedoch die Neuausrichtung der USA unter Donald Trump: «Die regelbasierte Ordnung wird infrage gestellt, ebenso das Verhältnis zwischen Europa und den Vereinigten Staaten.» Dies bedeute eine tektonische Verschiebung der globalen Machtverhältnisse – mit unmittelbaren Konsequenzen für die Schweiz.
Sowohl Trump als auch der russische Präsident Wladimir Putin hätten der Schweiz in den letzten Monaten signalisiert, dass sie sie nicht mehr als neutralen Akteur betrachteten. «Wenn andere uns nicht mehr als neutral behandeln, verlieren wir die Schutzwirkung dieser Rolle», sagte Pfister. Die Schweiz könne sich also nicht länger auf die Neutralität als Sicherheitsgarantie verlassen.
Pfister nutzt diesen geopolitischen Realitätscheck für eine deutliche Neupositionierung: Die Schweiz müsse «rasch und entschlossen handeln» und sich aktiv an der Stabilisierung Europas beteiligen. In einem Schritt, der innenpolitisch für Diskussionen sorgen dürfte, schlägt er vor, die Schweiz stärker in die europäische Verteidigungsarchitektur zu integrieren. «Unsere Sicherheit kann nicht länger isoliert gedacht werden», so Pfister. Er fordert, die bestehenden Kooperationen mit der EU zu vertiefen und neue Formen der Zusammenarbeit auszuloten – auch im Bereich der militärischen Sicherheit.
Er deutet an, dass hierzu eine neue politische Vorlage in Arbeit sei, mit dem Ziel, die Schweiz näher an das sicherheitspolitische Lager der EU heranzuführen – eine indirekte, aber klare Abkehr von der traditionellen Auslegung der Neutralität.
Pfister folgt damit inhaltlich dem Kurs seiner Vorgängerin Viola Amherd, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit stets betont hatte. Doch er geht noch weiter: «Die Neutralität war jahrzehntelang ein Pfeiler unserer Sicherheitspolitik. Heute ist sie eher eine Begrenzung als ein Schutzschild.»
Neben strategischen Grundsatzfragen spricht Pfister auch praktische Schwächen offen an – etwa die «inakzeptabel lange Dauer» bei Rüstungsbeschaffungen. Wie diese Prozesse gestrafft werden sollen, bleibt offen. Doch die Botschaft ist klar: Es braucht gemäss Pfister Tempo, politische Geschlossenheit und eine Bereitschaft, alte Gewissheiten zu hinterfragen.
Mit seinem Plädoyer für eine europäisch eingebettete Sicherheitspolitik will Pfister nicht nur auf internationale Umbrüche reagieren, sondern auch innenpolitische Gräben überwinden. «Es reicht nicht, Bedrohungen zu benennen. Wir müssen zusammenrücken – über Parteigrenzen hinweg.»
Ob Pfisters Kurswechsel auf politische Mehrheit stösst, bleibt abzuwarten. Klar ist: Er hat die schweizerische Sicherheitsdebatte mit wenigen Worten in eine neue Richtung gelenkt.
Auffällig ist, dass Pfister offensichtlich Ursache und Wirkung verwechselt. Zuerst war ab Februar 2022 der Kurswechsel der Schweiz mit der fast kompletten Übernahme der Sanktionen gegen Russland – offenbar auf Druck hinter den Kulissen. Erst dann kam die Feststellung Russlands und später der USA, sie würden die Schweiz nicht mehr als neutral betrachten. Das nützt Pfister nun aus, um die Schweiz sicherheitspolitisch noch mehr ins EU-Lager zu treiben und die Neutralität nicht mehr als Sicherheitsfaktor und politischen Pluspunkt zu sehen, sondern als Hemmschuh.
Man kann davon ausgehen, dass eine Mehrheit des Bundesrates, der Schweizer Landesregierung, diesen Kurs mitträgt. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die Bevölkerung dem Bundesrat die Grenzen aufzeigt. Durch die Neutralitätsinitiative würde dieses bewährte Konzept wieder in den Vordergrund gerückt und glaubwürdig werden. Wenn die Schweiz sich nicht nur an den Buchstaben des Neutralitätsrechtes hält (was sie bis heute immer noch tut), sondern auch eine glaubwürdige Neutralitätspolitik betreibt, dann wird sie auch wieder als neutral wahrgenommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass man die Position aller Konfliktparteien zwar nicht billigen, aber nachvollziehen muss. Dann wird die Schweiz wieder zur unverzichtbaren Plattform für gute Dienste und Diplomatie. Und dann ist Neutralität wieder ein Trumpf, um den man uns beneidet und nicht ein Hemmschuh. Und so ist Neutralität auch sicherheitspolitisch wieder ein Plus.
Es sind also nicht die Grossmächte, die die Schweiz nicht mehr als neutral betrachten, was dazu führt, dass die Schweiz sich sicherheitspolitisch in Richtung EU orientieren muss. Es ist umgekehrt: Die Schweiz ist in NATO-Nähe gerückt und wird aus diesem Grund nicht mehr aus neutral angesehen.
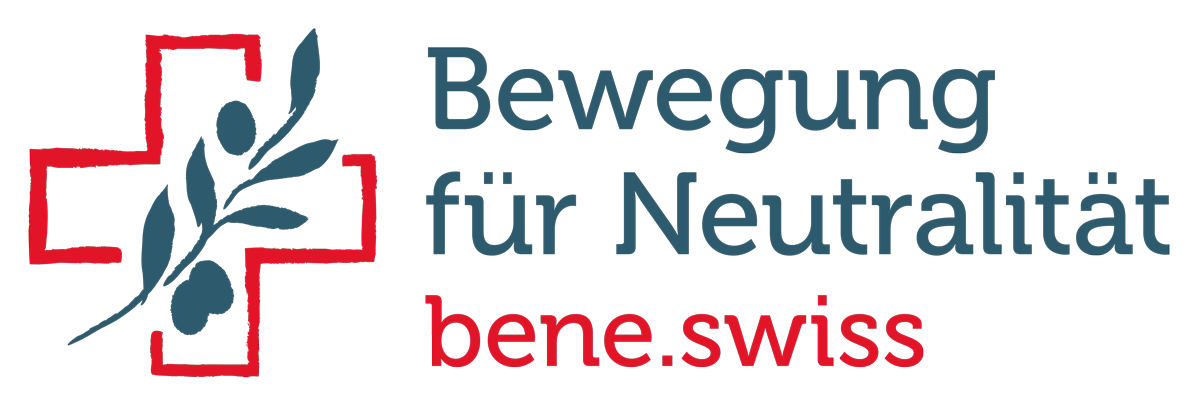
2 Antworten
Werter Herr Bundesrat Pfister
Die Neutralität wie es in der Bundesverfassung steht ist der Anker, der die Schweiz bis zum heutigen Tag vor einem Krieg bewahrt hat. Eine Beteiligung in der EU und der NATO führt die Schweiz in kriegerische Auseinandersetzungen. Der Bundesrat hat nicht die Kompetenz die Schweiz in diese kriegerischen Auseinandersetzungen zu führen. Es ist für mich nicht verständlich, dass Sie als neuer Bundesrat mit solchen Absichten die Schweiz in kriegerische Auseinandersetzungen bringen wollen. Die Schweiz hat sich in den 200 Jahren an keinen Kriegen mit Waffen beteiligt und sollte es auch in Zukunft nicht tun.
Sehr geehrter Herr Bundesrat Pfister
Ich sehe es gerade umgekehrt: Zuerst hat der Bundesrat die Neutralität teilweise ausser Kraft gesetzt – durch die Übernahme der Sanktionen gegen Russland und die Verbrüderung mit Selensky – erst danach, als Reaktion, nimmt das Ausland unsere Neutralität nicht mehr ernst. Durch die „Annäherung“ an EU und NATO droht uns, in einen Krieg hineingezogen zu werden, der uns nichts angeht. Würden Sie dann an die Front gehen – oder Ihre Kinder hinschicken?