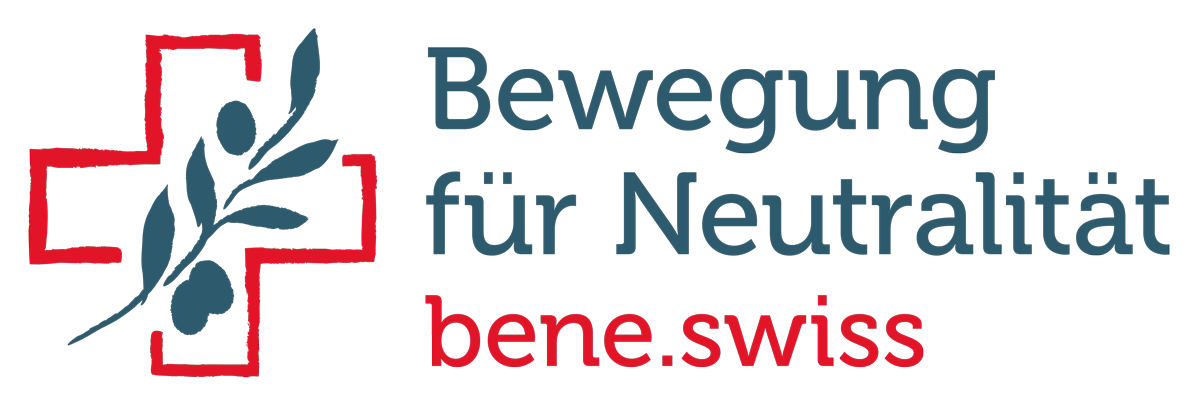Die KSZE zeigte, wie Neutralität Frieden stiften kann. Heute stellt sich die Frage: Kann die Schweiz durch eine klare Rückbesinnung auf ihre Neutralität erneut zur Friedensethik beitragen? Von René Roca
Die Schweiz war während der Zeit des Kalten Krieges, der von 1949 bis 1991 dauerte, immerwährend neutral. Sie hat so in vielen Konflikten mitgeholfen, einen Versöh-nungsprozess aufzugleisen. Damit hat sie dem eigenen Land, aber auch Europa und der Welt friedenspolitisch gedient. Die Schweiz war damals diplomatische Großmacht.
Seit dem Ende des Kalten Krieges setzte in der Schweiz allerdings eine Erosion der Neutralität ein. Schon beim Ersten Golfkrieg 1991 übernahm die Schweiz die Wirt-schaftssanktionen der Uno gegen den Irak, obwohl sie damals noch gar nicht Mitglied in diesem Gremium war. Sie kehrte damit gemäß eigener Einschätzung zur soge-nannten «differentiellen» Neutralität zurück, das heißt, sie war bereit, Abstriche an der Neutralität vorzunehmen. Die Wirtschaftssanktionen gegen den Irak hatten bekanntlich verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung, insbesondere auf die Kin-der. Zwischen 1991 und 2001 starben im Irak nach Angaben von UN-Organisationen wie Unicef oder WHO und vor allem auch gemäß den Berichten des ehemaligen Ko-ordinators des humanitären UN-Hilfsprogramms für den Irak, Hans-Christof von Sponeck, mehr als eine Million Menschen, darunter mehr als 500.000 Kinder unter fünf Jahren. Die Gründe waren fehlende Nahrungsmittel und medizinische Hilfe wie Medikamente etc. Die Schweiz trägt hier eine Mitschuld, da sie die Wirtschaftssankti-onen unterstützte. Das hat mit Neutralität nichts mehr zu tun.
Die Erosion der Neutralität setzte sich dann im Laufe der 1990er Jahre fort, bis sie dann mit der Übernahme der EU-Sanktionspakete ab März 2022 gegen Russland im Rahmen des Ukraine-Krieges praktisch pulverisiert wurde. Dieser Todesstoss für die Neutralität war der Grund, dass eine überparteiliche Arbeitsgruppe eine Volksinitiati-ve zur Wahrung der schweizerischen Neutralität lancierte. Sie wurde am 11. April 2024 mit knapp 130’000 gültigen Unterschriften in Bern eingereicht. Die Schweizer Regierung, der Bundesrat, lehnt diese Initiative ab und bemerkt in seiner Botschaft dazu, er wolle die Neutralität weiterhin «flexibel» handhaben. Nun läuft der parlamentarische Prozess. Aber auch wenn Regierung und Parlament, und sogar alle Parteien die Initiative ablehnten, kommt sie trotzdem nächstes Jahr zur Abstimmung. Das ist gelebte Demokratie in der Schweiz, das Volk hat das letzte Wort!
Der Abstimmungskampf läuft nun schon seit dem 11. April 2024 und hat in der Schweiz eine rege Debatte ausgelöst. Jede Initiative hat eine sogenannte «Vorwirkung». Das heißt, dass die Einreichung einer Initiative dafür sorgt, dass sich die Politiker, die Medien und die Bevölkerung mit dem Thema befassen und eine mehr oder weniger sachliche Diskussion stattfindet. Das ist der Kern der politischen Kultur in der Schweiz.
Im Rahmen der Debatten rund um die Schweizer Neutralität sind insbesondere auch historische Beispiele wichtig, welche die Rolle und die Bedeutung der Schweizer Neutralität deutlich aufzeigen. An diesen Beispielen kann man darlegen, wie wichtig die immerwährende Neutralität für die Schweiz, Europa und die Welt war und weshalb sie nun mithilfe der Initiative klarer in der Verfassung verankert werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch die «Konferenz über Sicherheit und Zusammenar-beit in Europa» (KSZE) von Bedeutung. Die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte jährte sich am 1. August 2025 zum fünfzigsten Mal. Dieser Prozess zeigt den hohen Wert der Schweizer Neutralität beispielhaft auf.
Vorgeschichte der KSZE
Die Initiative zur Einberufung einer europäischen Sicherheitskonferenz war 1969 von der Sowjetunion und den Staaten des Warschauer Pakts ausgegangen. Die Entspannungspolitik zwischen Ost und West hatte bereits Formen angenommen: Es existierte ein direkter Kommunikationskanal zwischen Moskau und Washington und auch Abrüstungsverhandlungen fanden statt. Ost und West strebten eine Verbesserung der Lage auf dem europäischen Kontinent an und überlegten sich, eine «Sicherheitsarchitektur» für Europa zu gestalten. Die Europäische Gemeinschaft (EG, heute EU), die NATO, die neutralen und bündnisfreien Staaten, aber auch der Ostblock hatten diesbezüglich teils divergierende Ansprüche. Dies hielt die Staaten aber nicht davon ab, mit gegenseitigen Konsultationen zu beginnen. Auch die Schweiz beteiligte sich rege daran.
1970 formulierte eine Arbeitsgruppe des schweizerischen Außendepartements einen Bericht und legte die Stossrichtung der schweizerischen Interessen dar. So lancierte die Schweizer Diplomatie, anknüpfend an ihre traditionelle Rolle als Schiedsrichterin zwischenstaatlicher Konflikte, den Vorschlag zur Einrichtung eines Systems friedlicher Streitbeilegung. Im Zentrum sollte die «Förderung zwischenmenschlicher Be-ziehungen zwischen Ost und West» stehen. Der Bericht forderte auch: «Man sollte das Recht auf Neutralität im Rahmen der Konferenz verankern.» Zudem bot man im Rahmen der «Guten Dienste» Genf als möglichen Austragungsort der Verhandlungen an.
Es folgten zwei Jahre der gegenseitigen Sondierungen und Gespräche quer durch Europa. Am intensivsten tauschte sich die Schweiz mit den anderen Neutralen aus, aber auch den Gedankenaustausch mit den Ländern Osteuropas empfand sie als überraschend fruchtbar. Die Hauptverhandlungen fanden dann ab September 1973, wie von der Schweiz vorgeschlagen, in Genf statt. Teilnehmer waren 35 Staaten: die sieben Staaten des Warschauer Paktes, die 15 NATO-Staaten und 13 neutrale Län-der. Die Neutralen resp. Blockfreien waren die folgenden Länder: Schweiz, Österreich, Schweden, Finnland, Jugoslawien, Zypern, Malta, San Marino, Lichtenstein, Irland, Island, Monaco und der Heilige Stuhl.
Thematisch hatte man vier Bereiche, sogenannte «Körbe» festgelegt. Der erste Korb betraf den Prinzipienkatalog zu grundlegenden Fragen der Souveränität und der zwi-schenstaatlichen Beziehungen, sicherheitspolitische Erwägungen im engeren Sinn und vertrauensbildende Maßnahmen im militärischen Bereich. Der zweite Korb war der Zusammenarbeit zwischen Ost und West in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt gewidmet. Korb drei sollte die «menschlichen Kontakte» zwischen Ost und West, wie es die Schweiz vorgeschlagen hatte, thematisieren. Im vierten Korb ging es schließlich um das Festlegen des weiteren Arbeitsprozesses der KSZE.
Die Rolle der Schweiz
Festzuhalten gilt, dass die neutrale Schweiz mit ihrer stillen Diplomatie hinter den Kulissen kontinuierlich eine bedeutsame Rolle wahrnahm. Zusammen mit den ande-ren Neutralen Österreich, Schweden und Finnland leistete sie wichtige Vermittlungsdienste und stärkte so den ganzen Prozess. Ab 1974 machte sie dies auch im Verbund mit dem blockfreien Jugoslawien sowie den Kleinststaaten Zypern, Malta, San Marino und Liechtenstein als «Gruppe der N+N», der «Neutrals and Non-Aligned».
Eine prinzipielle Kompromissbereitschaft der beiden Supermächte Sowjetunion und USA war nicht vorhanden. So spricht der Schweizer Delegationsleiter Rudolf Bindschedler in seinem Schlussbericht zum KSZE-Prozess von der «Starrheit der Großmächte». Er spricht in seinem Bericht auch immer wieder vom «Doppelspiel», das heißt vom Auseinanderklaffen zwischen den öffentlichen Stellungnahmen der Regierungen, vor allem der Großmächte, und der Haltung der Delegationen in Genf. Doch wenn die Diskussionen jeweils so weit in eine Sackgasse geraten waren, dass beide Lager keine Zugeständnisse einbringen oder akzeptieren konnten, ohne das Gesicht zu verlieren, wurden Vorschläge über den Kanal der Neutralen eingebracht. In solchen Schlüsselmomenten halfen die Schweizer Diplomaten mit, die Verhandlungen zu deblockieren und schließlich zu einem für alle Staaten annehmbaren Ergebnis zu führen. Temporär konnte also immer wieder eine Kompromissbereitschaft der Supermächte erreicht werden.
Bindschedler geht in seinem Schlussbericht ausführlich auf die Rolle der Neutralen während des ganzen Prozesses ein und schätzt dessen Einfluss als sehr hoch ein: «Das Ausmaß der gemeinsamen Interessen [d.h. der Neutralen und Nichtengagier-ten, d.V.] hat sich als viel größer erwiesen, als zuerst angenommen werden konnte. Die Zusammenarbeit in dieser Gruppe war eng und vertrauensvoll. Ihr einheitliches Auftreten hat die Blöcke zur Rücksichtnahme gezwungen und die Durchsetzung zahlreicher Postulate erleichtert. […] Für die Neutralen und Nichtengagierten ist ihr gegenseitiges Vertrauensverhältnis wohl eines der wichtigsten Konferenzergebnisse».
Schlussakt in Helsinki
Nach zweijährigen Verhandlungen, die vom 18. September 1973 bis zum 21. Juli 1975 in Genf stattfanden, unterschrieben am 1. August 1975 in Helsinki die Dele-gierten von 35 Staaten die KSZE-Schlussakte. Das Dokument ist in vier Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt behandelt «Fragen der Sicherheit in Europa», ge-gliedert in eine Erklärung von zehn Leitprinzipien:
-* 1. Souveräne Gleichheit, Achtung der der Souveränität innewohnenden Rechte
-* 2. Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt
-* 3. Unverletzlichkeit der Grenzen
-* 4. Territoriale Integrität der Staaten
-* 5. Friedliche Regelung von Streitfällen
-* 6. Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
-* 7. Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschließlich der Gedan-ken-, Gewissens-, Religions- und Überzeugungsfreiheit
-* 8. Gleichberechtigung und Selbstbestimmungsrecht der Völker
-* 9. Zusammenarbeit zwischen den Staaten
-* 10. Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben
Die Einschätzungen von Bindschedler zu den zehn Leitprinzipien sind sehr aufschlussreich: «Die Schlussakte enthält zahlreiche positiv zu würdigende Verhal-tensregeln für die Zukunft.» Dazu zählte er vor allem die zehn Leitprinzipien: «Zwar wiederholen die zehn Prinzipien über die gegenseitigen Beziehungen der Staaten zum grossen Teil geltendes Völkerrecht, wie es sich vor allem in der Charta der UN findet.» Der Katalog der Prinzipien entwickle aber wichtige Grundsätze weiter und vervollständige sie. Und weiter: «Im I. Prinzip wird ausdrücklich das Recht der Staaten unterstrichen, internationalen Organisationen anzugehören oder nicht, Mitglied einer Allianz zu sein oder nicht, sowie das Recht auf Neutralität.» Damit hatte eine wichtige Forderung der Schweiz Eingang in das Schlussdokument gefunden. Man stelle sich vor, die blockgebundenen Länder hätten von diesem Recht Gebrauch gemacht!
Der zweite Abschnitt der Schlussakte behandelt die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umwelt, Abschnitt drei beschäftigt sich mit Fragen der Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittelmeerraum und Abschnitt vier schließlich behandelt Grundsätze der Zusammenarbeit in humanitären und kulturellen Bereichen. Besonders für diesen Bereich hebt Bindschedler in seinem Schlussbericht die Bedeutung der Neutralen hervor:
«Die Ergebnisse […] auf dem Gebiete der menschlichen Kontakte, Reisen, Familienzusammenführung und Information sind weitgehend der Tätigkeit der Neutralen zuzuschreiben.» Dabei hätten, so Bindschedler, «politisch-psychologische Erwägungen» eine große Rolle gespielt. Besonders dieses Beispiel zeigt klar die politische und moralische Überlegenheit der neutralen Position. Bindschedler sieht aber durchaus auch die Defizite der Schlussakte. Sie sei kein völkerrechtlicher Vertrag: «Das ist zu bedauern, denn nur auf der Grundlage des Rechts erscheint eine dauerhafte und stabile Regelung möglich. […] So stellt die Schlussakte nur eine politische Deklaration, eine Absichtserklärung dar. Als solche kann sie psychologische und politische Wirkung erzielen. Ihr Wert kann jedoch erst in der Zukunft beurteilt werden.»
Bindschedler unterstreicht speziell beim 10. Leitprinzip «die Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben.» Das sind im Grunde zentrale friedensethische Grundsätze der Politik und, so Bindschedler, «positiv zu würdigende Verhaltensregeln für die Zukunft». Auch diese wichtige Vorschrift sei unter der massgebenden Führung der Neutralen zustande gekommen.
Zusammenfassend bemerkt Bindschedler: «Hingegen kann die Konferenz Ausgangspunkt einer politischen Weiterentwicklung sein und zu einer Verbesserung des Klimas unter den Staaten und zum Abbau der bestehenden Spannungen beitragen.»
Und speziell für die neutralen Länder: «Die Konferenz und die Schlussakte haben die Stellung der Kleinstaaten und der Neutralen verstärkt. Sie sind zu einem Faktor geworden, mit dem zwar nicht militärisch, aber doch politisch gerechnet werden muss. Für die Zukunft stellt sich die Aufgabe, diese Stellung zu halten.» Diese Stellung, so Bindschedler, sollte besonders für die «friedliche Streitbeilegung» genutzt werden. Er beschreibt schließlich die Rolle der neutralen Schweiz als diplomatische Großmacht: «Ganz allgemein hat die Konferenz zu einer Erhöhung des Gewichtes der Schweiz, ihrer Rolle und Bedeutung geführt. Es gelang, in zahlreichen Einzelpunkten schweizerische Vorschläge durchzusetzen. […] Mit den andern Neutralen hat sich die Schweiz als Vermittler betätigt und wesentlich zur Erzielung allseits befriedigender Lösungen beigetragen.» Diese Arbeiten, so Bindschedler, müssten fortgesetzt werden: «Am schädlichsten wäre Untätigkeit; es gilt auch hier die Regel, dass wir zwar Pessimisten der Erkenntnis, aber Optimisten der Tat sein müssen.»
Für die Schweiz unterzeichnete am 1. August 1975 Bundespräsident Pierre Graber die Schlussakte der KSZE. In seiner Ansprache vor den versammelten Delegierten sprach Graber das spezielle Engagement der neutralen Schweiz für das Gelingen der Konferenz an:
«Die Schweiz, am Schnittpunkt dreier Kulturkreise gelegen, die viel zur weltweiten Ausstrahlung des alten Kontinents beigetragen haben, hat immer das Leben Europas mitempfunden. Sie hat während ihrer ganzen, siebenhundertjährigen Geschichte dessen Höhepunkte und Bedrängnisse geteilt. Wie ich vor zwei Jahren, hier an der gleichen Stelle, erklärte, war die Neutralität meines Landes nie ein Alibi für eine Politik des ‹leeren Stuhles›, für Teilnahmslosigkeit und Rück-zug auf sich selbst. Sie hat in ihm im Gegenteil das Bedürfnis zur Solidarität und den Willen wachgerufen, jederzeit und nach Maßgabe seiner Mittel der internatio-nalen Gemeinschaft zu dienen.» Und weiter führt Graber in seiner eindringlichen Rede aus: «Das gute Einvernehmen ganz Europas ist und bleibt unser stetiger Wunsch. Die Tatsache, dass wir keinen Bündnissen oder Koalitionen beigetreten sind, entsprach somit zutiefst einer Berufung, die im weitesten Sinne europäisch ist. Deshalb freuen wir uns, dass die Option der Neutralität in das Kapitel der Prinzipien Aufnahme gefunden hat, die in den Beziehungen zwischen den Staaten Geltung haben sollen. Die Neutralität wurde damit als ein spezifisches Instrument der euro-päischen Sicherheit und Zusammenarbeit anerkannt.»
Graber spricht dann explizit die Verantwortung Europas an, über den Kontinent hinauszuschauen und auch die Entwicklungsländer zu unterstützen. Er will also die Sicherheitsarchitektur über Europa hinaus bauen, denken wir nur an den Vietnamkrieg, der im selben Jahr wie die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte 1975 endete, und dessen Folgen für Südostasien. Graber hebt dann die psychologische Dimension der menschlichen Beziehungen hervor. Es ginge darum, «einerseits vollständigere sicherere Strukturen in den innereuropäischen Beziehungen zu schaffen und andererseits in jedem unserer Länder und über die Grenzen hinweg die menschlichen Beziehungen zu entwickeln und harmonischer zu gestalten.» Die Dokumente, so Graber, stellten dafür einen ersten Anhaltspunkt dar: «Die Bestimmungen, die wir hier feierlich ver-abschieden werden, müssen […] morgen in die Tat umgesetzt werden. […] Es verlangt von allen Teilnehmerstaaten einen unabläßigen guten Willen, und es wird noch der größten Anstrengungen bedürfen, um dieses Ziel zu erreichen. […] Diese Texte werden letztlich so viel wert sein wie ihre Anwendung.»
Die Unterzeichnung der Schlussakte von 35 Staats- und Regierungschefs war ein starkes Zeichen der Entspannung, und das vor allem dank der neutralen Schweiz. Die Akte ist ein außergewöhnliches Dokument. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass mitten im Kalten Krieg, die Vertreter aller europäischen Staaten aus West und Ost inklusive Sowjetunion sowie USA und Kanada an einem Tische zusammenkamen, sich auf gemeinsame Werte einigten und sich zur Einhaltung gleicher Regeln verpflichteten. Europa sollte sicherer, menschliche Kontakte zwischen Ost und West sollten ausgebaut werden. Aber die Entspannung kriselte leider bald.
Schluss und Ausblick
In Folgekonferenzen sollte die Umsetzung der KSZE-Schlussakte in den einzelnen Staaten geprüft werden. Die KSZE blieb bis am Ende des Kalten Krieges als Forum des Ost-West-Dialoges bestehen und leistete einen großen, vielleicht sogar ent-scheidenden Anteil an der Überwindung des Kalten Krieges. Einerseits trug die Kontinuität des KSZE-Prozesses zu dieser Entwicklung bei, andererseits missachteten die USA und die Sowjetunion immer mehr die Grundprinzipien der Helsinki-Akte. So verschärften in den USA die Reagan-Jahre in den 80er Jahren das gegen-seitige Misstrauen und schürten mit Unterstellungen und Täuschungsmanövern den Unfrieden. Ronald Reagan liess sich von Neocons beraten und setzte zusammen mit der britischen Premierministerin Margaret Thatcher eine neoliberale Politik um, welche die Globalisierung befeuerte. Mit dem Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 1979 setzte auch die zweite Großmacht einmal mehr auf Konfrontation und Krieg und damit auf die Verschärfung des Ost-West-Konfliktes. Der wichtige Grundsatz der KSZE-Schlussakte, nämlich die «Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen nach Treu und Glauben» wurde gebrochen und viel Vertrauen wieder verspielt.
Das Ende des Kalten Krieges wurde 1990 im Rahmen eines KSZE-Sondergipfels in Paris gefeiert. Aber die «Charta von Paris» konnte mit ihrem Titel «Ein neues Zeitalter der Demokratie, des Friedens und der Einheit», nicht über die neuen Zerwürfnisse hinwegwegtäuschen. Die USA als einzige Weltmacht redeten gar von einem «Ende der Geschichte». Das war, wie wir heute wissen, eine schlichte Lüge. Bereits 1991 inszenierten die USA den Ersten Golfkrieg und seither führen sie permanent Krieg.
Wie bereits erwähnt, setzte damals mit der Übernahme der Wirtschaftssanktionen durch den Bundesrat in der Schweiz der Auflösungsprozess der Neutralität ein.
Obwohl die weltpolitische Lage prekär war, wurde beim KSZE-Gipfeltreffen am 5. und 6. Dezember 1994 in Budapest beschlossen, die KSZE in eine Organisation umzuwandeln. Sie wurde auf den 1. Januar 1995 als Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) fortgeführt, ist nun also bis heute eine permanente Konferenz mit dem Hauptsitz in Wien. Mit der Zerstörung Jugoslawiens während der 1990er Jahre begann der Abstieg der ohnehin geschwächten OSZE. Aktuell hat sie keine Bedeutung mehr.
Die Schweiz übernimmt nächstes Jahr das Präsidium der OSZE (wie schon 1996 und 2014). Die OSZE mit ihren heute 57 Teilnehmerstaaten und ständigen Instituti-onen wie dem Ministerrat und der parlamentarischen Versammlung ist eigentlich immer noch die weltweit größte Regionalorganisation für kooperative Sicherheit. Sie umspannt die nördliche Hemisphäre und könnte mithilfe einer Zusammenarbeit zum Beispiel mit den BRICS und anderen Organisationen der Länder des Südens ihr Gewicht wieder stärken. Diese Organisationen könnten als Modelle für die zwischenstaatliche Koexistenz in einer multipolaren Welt dienen. Die Schweiz hätte also nächstes Jahr mit dem Vorsitz der OSZE eine sehr wichtige Aufgabe und die Möglichkeit, die OSZE im Sinne der KSZE-Schlussakte wieder zu stärken. Sie sollte dringend wieder die gegenseitige Achtung der Länder, den Verzicht auf Gewalt, die Lösung von Konflikten ausschließlich mit diplomatischen Mitteln, den Verzicht auf Grenzänderungen und die Zusammenarbeit zum Wohle aller einfordern.
Deshalb ist die ebenfalls voraussichtlich nächstes Jahr zur Abstimmung kommende Initiative, welche die Neutralität klarer in der Schweizer Verfassung verankern will, so wichtig. Nicht nur für die Schweiz, auch für Europa und die Welt. Dies könnte auch die OSZE stärken, eingedenk der Bedeutung, welche die Neutralen für den KSZE-Prozess hatten. Mit Blick auf die Weltlage ist man so wohl, wie es Bindschedler sagte, ein Pessimist der Erkenntnis, aber man kann auch ein Optimist der Tat werden. In diesem Sinne muss die Schweizer Bevölkerung ermutigt werden, die Neutralitätsinitiative zu unterstützen. Da liegt noch ein grosses Stück Arbeit vor uns.
René Roca ist promovierter Historiker und Gymnasiallehrer. Er gründete und leitet das Forschungsinstitut direkte Demokratie ([www.fidd.ch->http://www.fidd.ch/]). Er ist Mitglied im Komitee der Neutralitätsinitiative ([www.neutralitaet-ja.ch->www.neutralitaet-ja.ch])