Im Zweiten Weltkrieg waren in der Schweiz Diskussionen um die Neutralität tabu. Entsprechende Hemmungen wirken bis heute nach und verhindern einen entspannten Blick auf das uralte, aber zukunftsträchtige Konzept.
Im Zweiten Weltkrieg war die Pressezensur in der Schweiz relativ mild. Im deutschsprachigen Raum war unser Land der einzige Ort, wo das Verbreiten von einigermassen korrekten Informationen möglich war.
Die Grundsätze der Pressekontrolle, erlassen vom Armeestab, Januar 1940:
- «Der Schweizer hat auch heute ein Recht auf Information durch die Zeitungen. Die Berichterstattung soll aber möglichst vollständig sein und Einseitigkeiten vermeiden.
- Jede Zeitung darf ihre Meinung und ihr Urteil äussern, soweit sie sich auf zuverlässige Quellen stützt und frei ist von Beleidigungen.
- Kritik ist erlaubt, soweit sie sachlich und in massvoller Weise geübt wird.
- Die Schweizer Presse soll dem Weltgeschehen vom schweizerischen Standpunkt aus gerecht werden; sie darf sich nicht zur Trägerin ausländischer Propaganda machen. Jede Beeinflussung vonseiten des Auslandes ist abzulehnen.
- Gerüchte und Voraussagen sind, sofern der Grunderlass ihre Wiedergabe zulässt, deutlich als solche zu kennzeichnen. Ratschläge und Schulmeistereien gegenüber dem Ausland sind zu unterlassen.
- Jede Diskussion über unsere Neutralität, welche deren Aufrechterhaltung gefährdet, widerspricht dem Grunderlass und hat zu unterbleiben. [1]«
Das Ziel der Medienkontrolle war er, die militärische Geheimhaltung zu wahren und dazu beizutragen, die Schweiz aus dem Krieg herauszuhalten. Von der Armee musste ein positives Bild gezeichnet werden und die Neutralität durfte nicht infrage gestellt werden. Es galt das Prinzip der Nachzensur – Zeitungen erschienen frei, konnten aber bei Verstössen gegen das obige bestraft werden. Meist blieb es bei einer Rüge. Der Bundesrat wollte auf diese Art Konflikte mit den Achsenmächten als Folge von Pressepolemiken vermeiden.
Solche Polemiken gab es dann trotzdem. Gerade der Schweizer Gesandte in Deutschland, der schon während des Krieges hoch umstrittene Hans Frölicher, machte in Bern Druck, die Presse stärker einzuschränken – ein Ansinnen, dem der Bundesrat widerstand. Was Frölicher wollte und ihm wohl seine Gesprächspartner in Berlin nahelegten, war die sogenannte Gesinnungsneutralität, wonach ein neutrales Land Meinungen in eine bestimmte Richtung unterbinden müsste.
Das war damals nicht und ist auch heute nicht die Idee der Freunde der Neutralität. Selbstverständlich darf man eine Meinung haben. Und die Medien sollten diese sagen dürfen. Die einzige legitime Grenze ist das Strafrecht und ein gewisser Persönlichkeitsschutz. Staatliche Stellen sollten dafür kämpfen, dass Pressefreiheit besteht, aber bei eigenen Stellungnahmen immer beachten, dass ein Neutraler in der Lage sein sollte, mit beiden Seiten zu reden. Ein neutraler Staat sollte danach trachten, beide Positionen zu verstehen – er muss sie aber nicht teilen. Früher hat man gesagt: Der Bundesrat schweigt in vier Sprachen.
Bei den obigen Grundsätzen der Pressekontrolle gibt es Dinge, die eine qualitativ hochstehende Publikation auch heute noch in ihr Redaktionsstatut aufnehmen könnte. Aus der Zeit heraus verständlich war der Punkt vier – er sollte den Nazipostillen den Boden entziehen. Auffällig ist der Punkt sechs. Damit wurde jede Diskussion über die Neutralität verhindert. Auch das ist aus der Zeit heraus verständlich. Allerdings wurde diese Diskussion dann in der Nachkriegszeit nicht mit dem nötigen Tiefgang nachgeholt. Die Aktivdienstgeneration stellte bei der Frage, warum die Schweiz verschont blieb, fast ausschliesslich die zum Widerstand entschlossene Armee in den Vordergrund.
Linksgrüne Historiker, diese sind an unseren Universitäten nicht zu knapp vertreten, stellen mit einem moralisierenden Unterton praktisch ausschliesslich auf wirtschaftliche Konzessionen der Schweiz an die Achsenmächte ab, auf Waffenlieferungen an dieselben und an den Umtausch von Gold in konvertible Franken durch die Schweizerische Nationalbank (SNB), die wohl ahnte, dass es sich hierbei zu einem guten Teil um Raubgold handelte. Zum Teil verstiegen sie sich zur Behauptung, die Kollaboration der Schweiz mit Nazideutschland habe den Krieg verlängert – was pure Spekulation ist, aber in Historikerkreisen bis heute nachwirkt[2].
Die Wahrheit liegt in der Mitte. Nachdem die Schweiz in der Zwischenkriegszeit dem Völkerbund beigetreten war, machte sie bei den von diesem verhängten Sanktionen gegen Italien im Jahr 1935/1936 nicht mit. Rückkehr zur «integralen» Neutralität nannte man das. Wie ich hier gezeigt habe, hat die Schweiz unter der Führung von Bundesrat Walther Stampfli (FDP/SO) dann im Krieg nach hartem Ringen mit Deutschland das Neutralitätsrecht in einem wichtigen Punkt verletzt. Sie lieferte an das kriegführende Deutschland Waffen, was sie den Alliierten – jedenfalls offiziell – vorenthielt.
Nach 1945 geriet die Neutralität deshalb in Verruf. Gerade die USA warfen der Schweiz Hehlerdienste vor. Durch die Formel von Neutralität und Solidarität gelang es Bundesrat Max Petitpierre (FDP/NE, im Amt 1944 bis 1961), Nachfolger seines glücklosen Parteikollegen Marcel Pilet-Golaz, die Schweizer Aussenpolitik völlig neu auszurichten, in einer Art, die bis vor Kurzen wegweisend war.
- Mit Hilfe der Neutralität sollte die Unabhängigkeit und Souveränität der Schweiz gewährleistet werden.
- Der Beitritt zu politischen Organisationen und Militärbündnissen war ausgeschlossen, während wirtschaftliche Integration und Zusammenarbeit willkommen war.
- Solidarisch sollte sich die Schweiz zeigen, indem sie sich als neutrale Plattform für gute Dienste und Verhandlungen anbot. Sein Gesellenstück lieferte Petitpierre mit der Indochinakonferenz von 1954 ab. Humanitäre Hilfe und Entwicklungshilfe lief an und die Schweiz trat den UNO-Sonderorganisationen bei.
Eine ehrliche Diskussion über die Neutralität fand und findet aber kaum statt. Das hängt auch damit zusammen, dass durch das Schweizer Verhandlungsgeschick und den bereits aufflammenden Kalten Krieg die offenen Fragen mit den Alliierten bereits 1946 schnell und mehr oder weniger im Sinne der Schweiz geregelt werden konnten.
Seit 2022 versucht der Bundesrat, die Schweiz immer enger an die NATO heranzuführen. Er hat damit bisher lediglich erreicht, dass die Schweiz für gute Dienste nicht mehr angefragt wird. Die Verhandlungen zwischen den USA und Russland finden in Saudi Arabien und in der Türkei statt – und nicht in Genf.
Es ist Zeit, dass wir eine offene und ehrliche Diskussion über Geschichte, Wert und Zukunft der Neutralität führen. Besser spät als nie – im Zusammenhang mit der Abstimmung über die Neutralitätsinitiative, die dieses jahrhundertealte aussenpolitische Instrument in der Bundesverfassung festschreiben will.
[1] Vgl. Henri Guisan/Jakob Huber u.a. (Hrsg.), Bericht des Chefs des Generalstabes der Armee an den Oberbefehlshaber über den Aktivdienst 1939 – 1945, Bern 1946, S. 437
[2] Vgl. z.B. Hans Ulrich Jost, Politik und Wirtschaft im Krieg. Die Schweiz 1938 bis 1948, S. 26 ff.
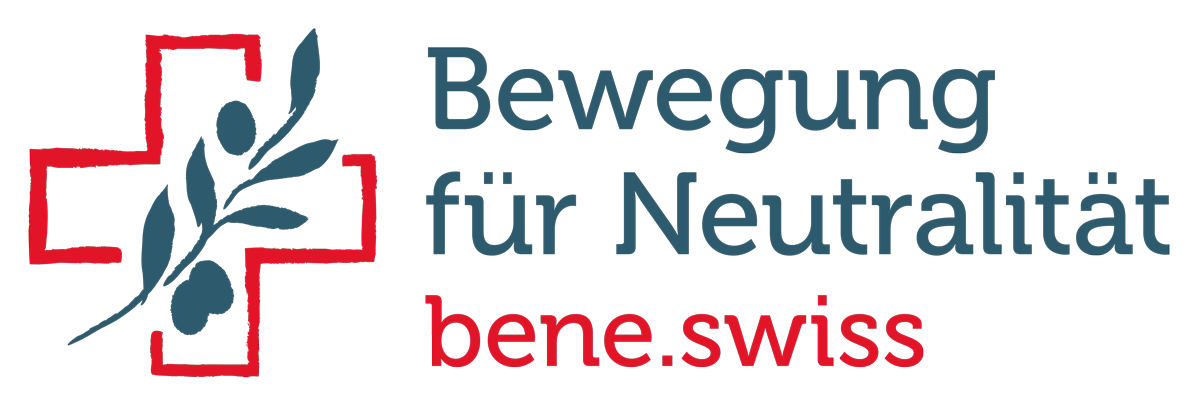
Eine Antwort
sehr informativ, vielen dank Daniel! die damaligen grundsätze der pressekontrolle sind eindrücklich und würden sich auch heute gut machen. Dein zweiter essay „wie die Schweiz im zweiten weltkrieg ihre neutralität aufrechthielt“ ist eine wichtige ergänzung.
zusammen machen sie deutlich, dass die handhabung und definition der Schweizer neutralität noch entwicklungspotential hat.