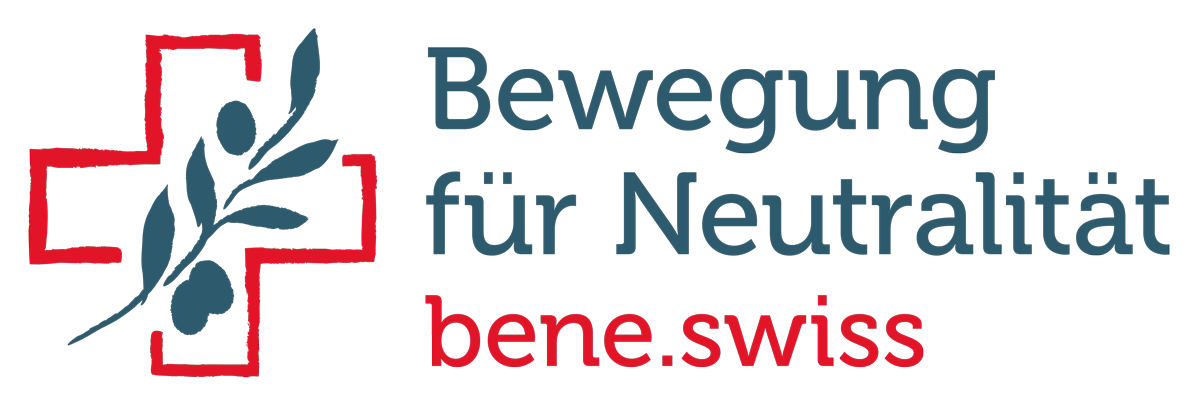Der frühere Schweizer Diplomat Jean-Daniel Ruch kritisiert in einem ausführlichen Interview mit der Plattform Die Schweiz online die Aussenpolitik des Bundesrates, insbesondere dessen Umgang mit der Neutralität und dem internationalen Recht. Er fordert eine sachlich-realistische Rückbesinnung auf den Kern schweizerischer Friedenspolitik – und warnt vor Einflussnahmen aus dem Ausland. Im Zentrum seiner Arbeit steht nun das 2024 gegründete Geneva Centre for Neutrality.
Jean-Daniel Ruch, früher Botschafter der Schweiz in Serbien, Israel und der Türkei sowie Sondergesandter im Nahen Osten, blickt mit Sorge auf die aktuelle aussenpolitische Ausrichtung der Schweiz. In einem Gespräch mit der Historikerin Ariet Güttinger stellte er die These auf, dass der Bundesrat mit der Übernahme der EU-Sanktionen gegen Russland im Februar 2022 die Neutralität des Landes gravierend beschädigt habe. Dies sei nicht nur ein politischer Fehler, sondern auch eine kommunikative Katastrophe gewesen. Ruch vermutete hinter dem Kurswechsel an jenem Wochenende massiven Druck von den USA, der EU oder der Schweizer Wirtschaft – dies habe der Bundesrat aber der Bevölkerung nicht transparent gemacht. «Man nimmt die Schweizer ein bisschen als Idioten», meinte er mit Blick auf den Kommunikationsstil der Regierung.
Ruch erklärte, Neutralität sei für die Schweiz nicht nur eine rechtliche Verpflichtung, sondern ein zentrales politisches Instrument und auch eine Frage der Wahrnehmung. Sie bestehe aus drei Stufen: dem Neutralitätsrecht, der Neutralitätspolitik und der internationalen Wahrnehmung. In Bezug auf Letzteres habe sich die Schweiz mit ihrer Haltung im Ukrainekonflikt und im Nahostkonflikt ins diplomatische Abseits manövriert.
Besonders kritisierte Ruch die einseitige Positionierung der Schweiz gegenüber Israel, etwa durch den Rückzug der Unterstützung für die UNRWA und durch die Klassifizierung der Hamas als Terrororganisation. Diese Kursänderung sei, so Ruch, nicht nur auf politische Überzeugungen zurückzuführen, sondern auf gezielte Beeinflussungsoperationen durch israelische Lobbyorganisationen wie NGO Monitor und UN Watch. Er verwies auf einen geheimen Bericht, den er selbst während seiner Zeit als Botschafter in Israel 2020 verfasst habe – dieser sei inzwischen teilweise durch Recherchen an die Öffentlichkeit gelangt. Ruch sprach in diesem Zusammenhang auch von der «Likud-Lobby» in der Schweiz, die über Verbindungen in die parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz–Israel direkten Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse nehme.
Das von ihm gegründete Geneva Centre for Neutrality wolle dem entgegenwirken, indem es einen Raum für Debatten über die Rolle der Schweiz als unparteiischer Vermittler in internationalen Konflikten biete. Ruch erklärte, man wolle neutral bleiben und keine Wahlempfehlung zur laufenden Neutralitätsinitiative abgeben, aber ein Forum für öffentliche Diskussionen schaffen. In der schweizerischen Bevölkerung gebe es eine politische Reife, die eine ehrliche Debatte über das Thema Neutralität verdient habe.
In Bezug auf die internationale Vermittlungstätigkeit kritisierte Ruch, dass sich die Schweiz nicht mehr als bevorzugter Ort für Friedensgespräche etablieren könne. Der Rückgang dieses Vertrauens sei nicht zuletzt auf die Entscheidung des Bundesrates im Ukrainekrieg zurückzuführen, die russische Seite habe die Schweiz seither nicht mehr als neutral betrachtet. Andere Länder wie Saudi-Arabien oder Katar seien inzwischen besser positioniert, auch weil sie «Realpolitik» betrieben und enge Beziehungen zu beiden Seiten pflegten – etwa Mohammed bin Salman sowohl zu Putin als auch zu Trump. Die Schweiz hingegen habe keine politischen Führungspersönlichkeiten mehr mit solchem Einfluss oder diplomatischem Geschick. Ueli Maurer sei hier eine Ausnahme gewesen.
Ruch machte deutlich, dass die Neutralität nicht mit Passivität zu verwechseln sei. Vielmehr müsse die Schweiz im eigenen Interesse handeln. Er bezeichnete sich selbst als Vertreter der realistischen Schule: «Die Welt besteht aus Kräfteverhältnissen, alle Akteure sind gleichzeitig gut und schlecht.» Wer konsequent gegen das Böse kämpfen wolle, müsse bereit sein, selbst in den Krieg zu ziehen – das sei jedoch weder realistisch noch schweizerisch.
Die Debattenkultur in der Schweiz kritisierte er ebenfalls. Die Medien, insbesondere die NZZ, hätten Andersdenkende im Ukrainekrieg diffamiert, statt eine offene Diskussion zuzulassen. Ihm selbst sei vorgeworfen worden, ein «Putinversteher» zu sein, nur weil er mit dem russischen Botschafter an einer Diskussion teilgenommen habe. Der Begriff sei «so dumm», dass er jeder liberalen Debattenkultur widerspreche.
Zum Abschluss erinnerte Ruch an die historischen Wurzeln der Schweiz als Rechtsstaat. Die drei Schweizer Friedensnobelpreisträger – Henri Dunant, Elie Ducommun und Albert Gobat – stünden sinnbildlich für eine Tradition, in der Recht über Macht gestellt werde. Diese Tradition gelte es zu verteidigen. «Recht statt Macht, das liegt in der Essenz der Schweiz.»
Er betonte, dass gerade ein kleines Land wie die Schweiz auf internationales Recht angewiesen sei, um sich in einer Welt der Machtblöcke behaupten zu können. Deshalb müsse es sich stärker denn je für Rechtsstaatlichkeit, Humanität und echte Neutralität einsetzen – nicht aus moralischen, sondern aus strategischen Gründen.
Jean-Daniel Ruch fordert eine Rückkehr zu einer glaubwürdigen, souveränen und prinzipiengeleiteten Neutralitätspolitik der Schweiz. Nicht Machtpolitik, sondern internationales Recht und Vermittlung seien der rote Faden, an dem sich die Schweiz orientieren müsse – und dies, so betont er, nicht aus Altruismus, sondern aus klarem Eigeninteresse.
Das Interview führte Ariet Güttinger. Es erschien auf der Plattform Die Schweiz online. Dieser Artikel ist eine Zusammenfassung des ausführlichen Gespräches.