Die Kräfte der Annäherung an die Nato sehen sich bereits mit einem Bein im Krieg

Das Setting der Abendveranstaltung der Aarauer Demokratietage vom 3. April war geschickt gewählt. «Wir müssen uns gut überlegen, wie wir uns militärisch besser aufstellen und mit welchen Partnerschaften,», erklärte die UNO-Botschafterin Pascale Baeriswyl zu Beginn per Zoom aus New York.
Mit anderen Worten: Die Neutralität ist nicht mehr als Sicherheit zu betrachten, nicht in fremde Konflikte hineingezogen zu werden. Und: Militärische Partnerschaften scheinen zwingend.
Das widerspricht der historischen Erfahrung. Die Neutralität hat die Schweiz über 200 Jahre lang vor Krieg und militärischen Konflikten bewahrt. Aber diesen blinden Fleck darf man heute auch als UNO-Botschafterin als reale Sicht der Dinge unwidersprochen in den Debattenraum stellen.
Den nächsten Schritt tat dann die Politphilosophin Katja Gentinetta, Redaktorin des Berichts der «Studienkommission Sicherheitspolitik» des VBS. Sie ist das weibliche Gesicht der Kreise, die eine weitere Annäherung an die Nato und die Sicherheitsarchitektur der EU anstreben.
Eine Ausweitung der russischen Aggression auf Nato-Länder sei nicht auszuschliessen, sagte sie und damit sei «Europas Stabilität … als Erstes gefährdet und damit auch die Schweiz».
Im Klartext: Die Schweiz wird als Land dargestellt, dessen Neutralität bereits so weit beschädigt ist, dass sie mehr oder weniger automatisch in einen Krieg zwischen der Nato und Russland hineingezogen wird.
Falls die Schutzwirkung der Neutralität bereits beeinträchtigt ist, gibt es zwei Möglichkeiten:
sie wiederherstellen – das will die Neutralitätsinitiative – oder sie weiter flexibilisieren bis hin zu gemeinsamen Rüstungsprogrammen und Verteidigungsszenarien mit anderen Militärblöcken. Das wollen Katja Gentinetta und die hinter ihr stehenden Kräfte – «die eigene und die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit stärken».
Im anschliessenden Podium diskutierten die Aargauer Ständerätin Marianne Binder (Mitte), Europa- und Wirtschaftsvölkerrechtsprofessor Thomas Cottier und Daniel Möckli, Leiter des Thinktanks des Center for Security Studies der ETH Zürich auf der Seite der Annäherer und Nationalrat Michael Götte (SVP/SG)) und Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne/ZH) auf der Seite der Verteidiger der Neutralität.
Die wichtigsten Leitbegriffe aus der Diskussion:
- «bewaffnete Neutralität in internationaler Kooperation» (Binder)
- «nicht jeder exportierte Helm bricht gleich das Neutralitätsrecht» (Möckli)
- die Neutralitäts-Initiative ist eine «Pro-Putin-Initiative» (Cottier)
Binders Begriff der der «bewaffneten Neutralität in internationaler Kooperation» ist geschickt gewählt. Sie vermeidet es, konkret zu werden, gemeint ist aber die weitere «Annäherung».
Möckli bagatellisiert mit seiner Aussage die anstehende Revision des Kriegsmaterialgesetzes. Die Schweiz als Technologieland wird mit Sicherheit nie Stahlhelme exportieren, die anderswo günstiger hergestellt werden können.
Interessant ist die Aussage Cottiers, der eine Position von George W. Bush übernimmt: Wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Wer neutral ist, ist offenbar für Putin. Es stimmt, dass die Neutralitätsinitiative die Beteiligung an «nichtmilitärischen Zwangsmassnahmen» verbietet.
Nur: Die Sanktionen des Westens haben vor allem ihm selber geschadet und nicht Russland, das passenderweise mit dem bereits ausreichend dämonisierten Putin gleichgesetzt wird.
Die bisherige nichtmilitärische Kriegsführung des Westens liefert im übrigens reichlich Argumente, sich nicht daran zu beteiligen. Sie hat die Energie verteuert, die Inflation angeheizt und die Verschuldung vorangetrieben.
Die Hauptwaffe der Annäherer ist die Angst vor einem Angriff Russlands. Sie sind in der komfortablen Lage, diese Angst durch eine weitere Annäherung zu schüren und sie mit ihren Medien in die Bevölkerung zu tragen. Sie kontrollieren das Spiel.
Wir von der Bewegung für Neutralität wollen vor allem das Vertrauen in die Neutralität als die bestmögliche Position stärken, sich aus Konflikten herauszuhalten und den Frieden zu sichern.
Dieses Vertrauen können wir zwar nicht über die Medien aufbauen, aber über die vielen Menschen, die an die Seele der Schweiz glauben und bereit sind, für ihre Überzeugung aufzustehen.
Persönliche Kontakte sind also gefragt und ein bisschen Mut, Gesicht zu zeigen.
Quelle der Zitate: Aargauer Zeitung: «Bewaffnete Neutralität mit internationaler Kooperation»: So sieht Marianne Binder die geopolitische Rolle der Schweiz. 3.4.202
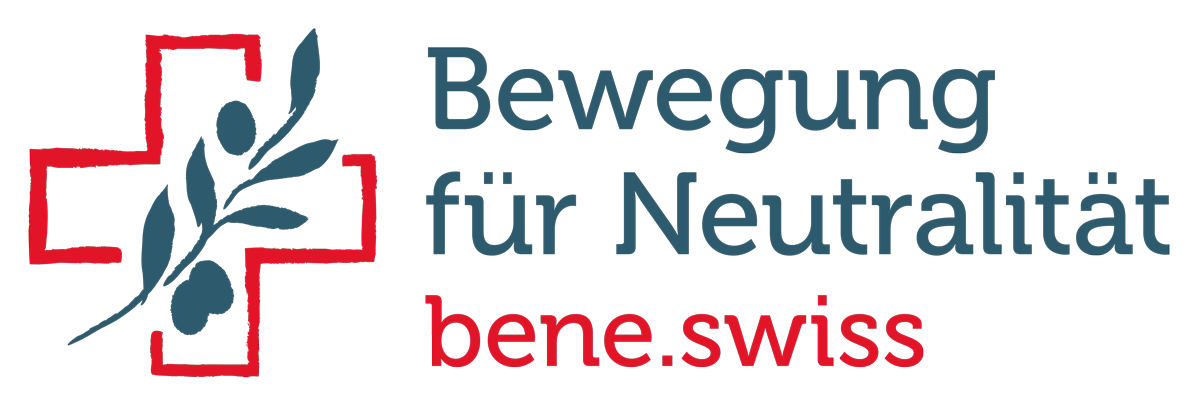
Eine Antwort
Wenn wir uns der Nato annähern, wird sie über kurz oder lang Druck ausüben, uns ganz anzuschliessen. Dann wären wir gezwungen, im Bündnisfall auch mitzumachen. Die Nato, ursprünglich eine Verteidigungsorganisation, hat einen Angriffskrieg auf Afghanistan ausgeführt. Solch eine Situation kann sich jederzeit wiederholen, vor allem da unsere Politiker in letztere Zeit nur noch panisch reagieren. Wollen wir das wirklich?