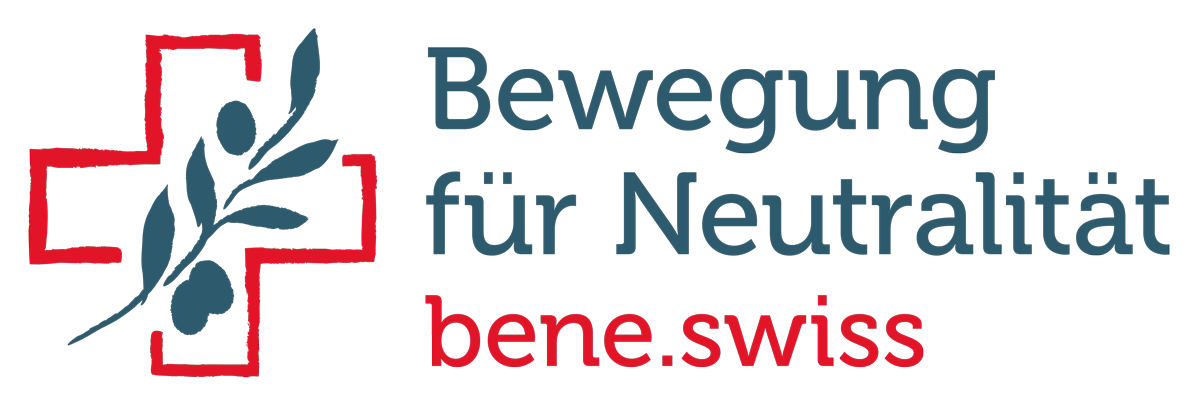Der Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow im November 1985 in Genf war ein weltpolitisches Schlüsselereignis – und ein Höhepunkt der Schweizer Politik der Guten Dienste. Doch was als diplomatischer Triumph begann, offenbarte später auch Schwächen im Selbstverständnis der Schweizer Außenpolitik.
Als sich im Herbst 1985 die beiden mächtigsten Männer der Welt – US-Präsident Ronald Reagan und der neue sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow – zu einem historischen Gipfel in Genf trafen, blickte die Welt auf die Schweiz. Das Treffen markierte nicht nur den Beginn der Entspannung im Kalten Krieg, sondern stellte auch die Schweizer Diplomatie ins Rampenlicht – als neutraler Gastgeber, als Organisator und als Symbol für Stabilität. Der pensionierte Schweizer Diplomat Paul Widmer berichtete vor einigen Tage in der Weltwoche darüber – und zog Lehren für heute.
Die Voraussetzungen für den Gipfel waren denkbar angespannt. Die Ost-West-Beziehungen waren auf einem Tiefpunkt. Auf sowjetischer Seite herrschte seit Jahren Reformstillstand – bis im März 1985 mit Michail Gorbatschow eine neue Generation die Macht übernahm. Für Reagan war das der lang ersehnte Anlass, wieder mit Moskau ins Gespräch zu kommen.
Ein direkter Besuch kam aus politischen Gründen nicht infrage. Die USA luden zwar nach Washington ein, doch Gorbatschow lehnte ab. Schließlich einigte man sich auf neutralen Boden – Genf.
Ohne großes Zutun der Schweiz einigten sich Washington und Moskau auf Genf. Die offizielle Anfrage erfolgte im Juli 1985 – vorbereitet war sie längst. Paul Widmer, damals Botschaftssekretär in Washington, erinnert sich, wie beiläufig im US-Außenministerium gefragt wurde, ob die Schweiz zu einem solchen Gipfeltreffen bereit wäre. Die Antwort: ein klares Ja – ohne Zögern, aber auch ohne sich in den Vordergrund zu drängen.
Bundespräsident Kurt Furgler empfing beide Außenminister – George Shultz und Andrei Gromyko – mit einer seltenen Mischung aus staatsmännischem Format, diplomatischer Sensibilität und persönlichem Feingefühl. Seine Worte zur Rolle Amerikas in der Verteidigung der freien Welt beeindruckten Shultz so sehr, dass sie in dessen Memoiren festgehalten wurden. Ein Zeichen dafür, wie stark die Schweizer Gastgeberrolle wahrgenommen wurde.
Auch im Umgang mit Gorbatschow bewies Furgler Fingerspitzengefühl. Er wich bewusst vom diplomatischen Skript ab, sprach ihn in angepasstem Ton an und zeigte ein Verständnis für kulturelle wie politische Unterschiede. Dass Gorbatschow ihn daraufhin zu einem Staatsbesuch in die Sowjetunion einlud – und gleichzeitig über das föderale Schweizer Regierungssystem schmunzelte – zeugt von gegenseitigem Respekt.
Doch der Gipfel war kein Selbstläufer. Hinter den Kulissen drohte er sogar zu scheitern. Gorbatschow war nach der ersten Gesprächsrunde frustriert – so sehr, dass er laut späteren Berichten sogar erwog, den Gipfel frühzeitig zu verlassen. Erst das Eingreifen seiner Frau Raissa und seines Außenministers Schewardnadse – dieser war in der Zwischenzeit auf Gromyko gefolgt – konnte ihn davon abhalten. Trotzdem wurde bereits am ersten Tag ein Folgegipfel in Washington vereinbart – und Gegeneinladungen nach Moskau ausgesprochen.
Für die Schweiz bedeutete der Gipfel eine logistische Mammutaufgabe. Über 3500 Journalisten, Hunderte Delegationsmitglieder und die Sicherheitsvorkehrungen für zwei Supermächte forderten höchste Präzision.
Nicht nur der reibungslose Ablauf, sondern auch die diskrete Zurückhaltung der Schweiz trugen zum Erfolg bei. Doch genau hier begann auch eine problematische Entwicklung: Die Gastgeberrolle wurde zunehmend mit politischem Mitgestaltungsanspruch verwechselt.
Was 1985 als Höhepunkt galt, offenbarte in den Folgejahren Risse. Beim Außenministertreffen 1991 zwischen US-Aussenminister James Baker und seinem irakischen Amtskollegen Tariq Aziz versuchte die Schweiz erneut, sich diplomatisch einzubringen – durch bilaterale Vorgespräche mit beiden Seiten. Die USA reagierten irritiert. Die Schweiz, so die Kritik, habe die Rolle als neutraler Gastgeber überreizt. Und als ein gemeinsames Abendessen mit dem irakischen Minister vorgeschlagen wurde, reagierte Baker scharf: «Ich teile doch nicht den Tisch mit jemandem, dem ich bald den Krieg erkläre.»
Solche Missverständnisse führten dazu, dass die Schweiz international an Profil verlor – nicht wegen schlechter Organisation, sondern wegen eines überdehnten Rollenverständnisses. Ein «gewisser Amateurismus», wie es Botschafter Klaus Jacobi später nannte, habe den Ruf der Schweiz als Vermittler untergraben.
Der Gipfel von 1985 war ein historischer Glücksfall – für die Weltpolitik und für die Schweiz. Doch er darf nicht als Maßstab für Selbstinszenierung dienen. Die Politik der Guten Dienste lebt von Zurückhaltung, Vertrauen und Verlässlichkeit. Sie verlangt, dass der Gastgeber nicht im Mittelpunkt steht – sondern jenen Platz einnimmt, der ihm von den Konfliktparteien zugewiesen wird.
Heute, in einer Welt multipolarer Spannungen und neuer geopolitischer Frontlinien, stellt sich die Frage erneut: Ist die Schweiz bereit? Nicht nur organisatorisch, sondern auch mental. Kann sie sich wieder als zuverlässiger Ort der Verständigung positionieren – durch diskrete Diplomatie statt demonstrativen Auftritt?
Die Geschichte des Genfer Gipfels liefert eine klare Lehre: Gute Dienste sind kein politisches Schaufenster. Sie sind stille Exzellenz – eine Kunst, die schweizerische Diplomatie einst meisterhaft beherrschte. Und vielleicht wieder lernen muss.
Die Lehren wären zum Beispiel: Wieder eine klarere Neutralitätspolitik verfolgen, sich von staatlicher Seite zurückhalten mit aussenpolitischen Äusserungen. Das Gegenbeispiel zum Gipfel von Genf war die Bürgenstock-Konferenz (2024). Die Schweiz hatte sich nicht nur durch die praktisch integrale Übernahme der Sanktionen gegen Russland positioniert, sondern auch durch unbedachte Äusserungen von zum Beispiel Aussenminister Cassis. Dieser war zum Beispiel auf dem Berner Bundesplatz an einer Pro-Ukraine-Demonstration aufgetreten und hatte den ukrainischen Präsidenten dazu per Video eingeblendet. Zudem wurde der Plan zur Konferenz früh öffentlich und die Schweiz konnte nicht mehr auf eine Einladung an Russland beharren. Und schliesslich sieht man auf den Konferenzfotos den geradezu penetranten Versuch der damaligen Bundespräsidentin Viola Amherd, sich in den Vordergrund zu rücken.
Die Gespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine, die jetzt wieder laufen, finden wohl deshalb ohne Schweizer Beteiligung statt.